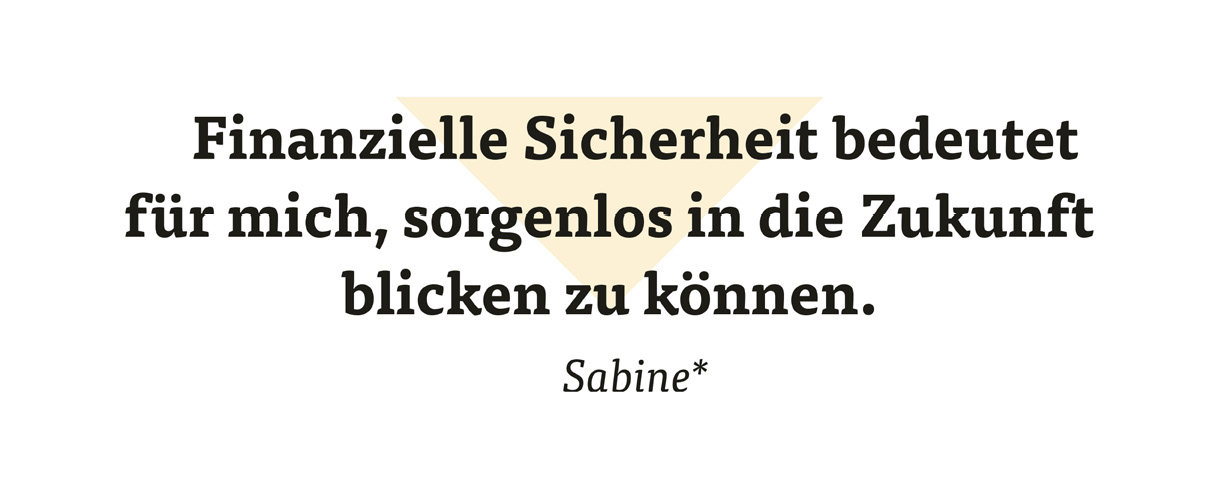Freundschaft
Von der Freundschaft
// Alexandra Kienzl //

Vor kurzem war die feministische Bestseller-Autorin Teresa Bücker in Bozen und sprach über Zeitgerechtigkeit. Darüber, dass der Lohnarbeit sehr viel Platz in unseren Leben eingeräumt wird, Frauen aber zusätzlich meist noch Pflege- und Erziehungsarbeit zu stemmen hätten, sodass kaum Zeit für anderes bleibt: für Hobbys, Partner, Freunde. Dabei sei gerade Freundschaft eine so wichtige Säule im Leben. An dieser Stelle schaltete sich bei mir das schlechte Gewissen ein. Mein Freundschaftsgarten, wenn ich mir ihn so vorstelle, ist ein eher mäßig liebevoll gepflegter. Da gibt es zwei, drei sehr robuste Gewächse, die zum Glück mit einem gelegentlichen Regenguss zufrieden sind und trotz nachlässiger Hinwendung meinerseits blühen. Da gibt es aber auch eine Reihe recht zarter Pflänzchen, denen ein wenig Aufmerksamkeit hie und da nicht genügt. Die bestimmt wunderbar wachsen würden, wenn man sich ordentlich um sie kümmerte – was im derzeitigen Lebensabschnitt zwischen gefühlt hunderten Verpflichtungen aber nicht drin ist. Also gehen ein paar von ihnen ein, andere halten tapfer durch und zehren von vergangenen Tagen – noch.
Ein schöner Anblick ist das nicht, und gesund ist es auch nicht: Wer erfolgreich Freundschaften pflegt, lebt länger, stärkt sein Immunsystem, senkt das Risiko an Demenz zu erkranken und – was Wunder – beugt Depressionen vor. Ärzte müssten uns praktisch Freundschaften verschreiben, und doch scheint uns genau dafür oft die Zeit zu fehlen: Für Sport und Partnerschaft schaufelt man sich noch irgendwie ein paar Stündchen frei, Freunde hingegen werden oft en passant abgespeist, per Whatsapp auf Standby gehalten. Zu verlockend ist abends die Couch statt des gemeinsamen Pizzaessens, neben dem schon lang versprochenen Anruf gibt es zig organisatorische Telefonate, die geführt werden müssten und dann auch Priorität bekommen. Verständlich, die Erschöpfung der zwischen häuslichen und außerhäuslichen Pflichten Aufgeriebenen ist groß, und meist ist es nicht nur eine Seite, die es „glaggeln“ lässt, sondern ein gegenseitiges Vertrösten auf den unbestimmten Zeitpunkt, an dem es dann „leichter geht“. Bevor der aber eintrifft, ist oft schon Funkstille eingekehrt. Das ist nicht nur schade, sondern fatal: Wir schließen als Erwachsene Freundschaften nicht mehr so beiläufig wie in der Schule oder während des Studiums; dass Freundschaften einfach so passieren, das schließt unser durchgetaktetes Dasein in den immergleichen Sphären beinahe aus. Freundschaft wird zu etwas, das man sich erarbeiten muss, zu einer Gelegenheit, die sich nur mehr selten bietet und dann beherzt ergriffen werden muss. Schon wieder Arbeit also.
Die sozialen Medien bieten da keinen Ersatz, auch wenn sie uns scheinbar ganz unkompliziert mit „Freunden“ versorgen: Langjährige Freunde kennen uns so, wie wir wirklich sind, und nicht bloß so, wie wir gerne wären. Unsere Fadheit halten sie geduldig aus, während sich die Online-Amigos unversehens einem anderen Profil zuwenden, sobald wir mal nicht so unterhaltsam sind. Und mit der Dankbarkeit um die gemeinsam bewältigten Lebensphasen kann das Prickeln noch so vieler Likes nicht mithalten. Lauter gute Gründe also, um sich aufzuraffen und mehr in unsere Freundschaften in der wirklichen Welt zu investieren. Das Feld dünnt ohnehin von selbst aus: Menschen und Weltanschauungen ändern sich, einige fallen ganz von selbst weg, bei manchen macht man vielleicht die bittere Erfahrung, dass man ihnen weniger wert ist, als sie uns. Aber bestimmt gibt es diese zwei, drei, die es sich unbedingt verdient haben, dass man dranbleibt, auch wenn es grad schwierig ist. Freunde sind tatsächlich die Familie, die man sich aussucht, sie geben eine Sicherheit, auf die keine*r von uns verzichten kann, und dafür kann man abends schon mal die Füße hoch bekommen.
Ein schöner Anblick ist das nicht, und gesund ist es auch nicht: Wer erfolgreich Freundschaften pflegt, lebt länger, stärkt sein Immunsystem, senkt das Risiko an Demenz zu erkranken und – was Wunder – beugt Depressionen vor. Ärzte müssten uns praktisch Freundschaften verschreiben, und doch scheint uns genau dafür oft die Zeit zu fehlen: Für Sport und Partnerschaft schaufelt man sich noch irgendwie ein paar Stündchen frei, Freunde hingegen werden oft en passant abgespeist, per Whatsapp auf Standby gehalten. Zu verlockend ist abends die Couch statt des gemeinsamen Pizzaessens, neben dem schon lang versprochenen Anruf gibt es zig organisatorische Telefonate, die geführt werden müssten und dann auch Priorität bekommen. Verständlich, die Erschöpfung der zwischen häuslichen und außerhäuslichen Pflichten Aufgeriebenen ist groß, und meist ist es nicht nur eine Seite, die es „glaggeln“ lässt, sondern ein gegenseitiges Vertrösten auf den unbestimmten Zeitpunkt, an dem es dann „leichter geht“. Bevor der aber eintrifft, ist oft schon Funkstille eingekehrt. Das ist nicht nur schade, sondern fatal: Wir schließen als Erwachsene Freundschaften nicht mehr so beiläufig wie in der Schule oder während des Studiums; dass Freundschaften einfach so passieren, das schließt unser durchgetaktetes Dasein in den immergleichen Sphären beinahe aus. Freundschaft wird zu etwas, das man sich erarbeiten muss, zu einer Gelegenheit, die sich nur mehr selten bietet und dann beherzt ergriffen werden muss. Schon wieder Arbeit also.
Die sozialen Medien bieten da keinen Ersatz, auch wenn sie uns scheinbar ganz unkompliziert mit „Freunden“ versorgen: Langjährige Freunde kennen uns so, wie wir wirklich sind, und nicht bloß so, wie wir gerne wären. Unsere Fadheit halten sie geduldig aus, während sich die Online-Amigos unversehens einem anderen Profil zuwenden, sobald wir mal nicht so unterhaltsam sind. Und mit der Dankbarkeit um die gemeinsam bewältigten Lebensphasen kann das Prickeln noch so vieler Likes nicht mithalten. Lauter gute Gründe also, um sich aufzuraffen und mehr in unsere Freundschaften in der wirklichen Welt zu investieren. Das Feld dünnt ohnehin von selbst aus: Menschen und Weltanschauungen ändern sich, einige fallen ganz von selbst weg, bei manchen macht man vielleicht die bittere Erfahrung, dass man ihnen weniger wert ist, als sie uns. Aber bestimmt gibt es diese zwei, drei, die es sich unbedingt verdient haben, dass man dranbleibt, auch wenn es grad schwierig ist. Freunde sind tatsächlich die Familie, die man sich aussucht, sie geben eine Sicherheit, auf die keine*r von uns verzichten kann, und dafür kann man abends schon mal die Füße hoch bekommen.